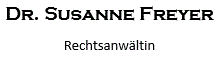Für Rechtsgeschäfte von Personen mit Behinderung stellt sich immer die Frage, ob die Person hinsichtlich dieses Rechtsaktes geschäftsfähig ist oder nicht. Menschen mit Behinderung wird die Geschäftsfähigkeit keineswegs generell entzogen. Grundsätzlich gilt die Geschäftsfähigkeit als gegeben, wenn ein Mensch in der Lage ist, die Bedeutung seines Verhaltens zu erkennen und auch nach dieser Einsicht zu handeln. Für Bereiche, in denen diese Einsichtsfähigkeit nicht gegeben ist, kann ein*e Erwachsenenvertreter*in bestellt werden. In sämtlichen anderen Bereichen gilt die Person als geschäftsfähig.
In diesem Beitrag wird exemplarisch dargestellt, welche rechtlichen Handlungs-möglichkeiten für Menschen mit Behinderung bestehen können:
Gewählte Erwachsenenvertretung
Wenn eine Person nicht voll geschäftsfähig ist, allerdings sehr wohl entscheiden kann, wer sie vertreten soll, kann sie ein*e gewählte Erwachsenenvertreter*in bestimmen. Dies ermöglicht dem/der Betroffenen, trotz abgeschwächter Entscheidungsfähigkeit, eine*n Vertreter*in zu bestellen. Gewählte*r Erwachsenen-vertreter*in kann jede nahestehende Person sein, zu der ein Vertrauensverhältnis besteht. Die*Der Erwachsenenvertrer*in wird weiters nur für Angelegenheiten bestellt, die die*der Betroffene nicht selbst wahrnehmen kann. Die gewählte Erwachsenenvertretung muss demnach keine umfassende Vertretung darstellen, sondern kann auch nur für bestimmte Bereiche vorgesehen werden.
Die gewählte Erwachsenenvertretung wird in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis eingetragen.
Testament
Grundsätzlich kann jede volljährige Person ein Testament errichten – genauso Menschen mit Behinderung. Es gibt also keine Beschränkung auf bestimmte Testamentsformen für Personen mit Behinderung. Es muss nur für den Testiervorgang die Entscheidungsfähigkeit – also das Bewusstsein, hier eine erbrechtliche Verfügung zu treffen – vorhanden sein.
Derjenige, der die Testierfähigkeit nach dem Ableben des Testamentsverfassers anzweifelt, muss auch den Beweis für diese Behauptung erbringen. Daraus können durchaus langwierige Auseinandersetzungen resultieren, weshalb es sich im Zweifel empfiehlt, eine ärztliche Bestätigung über die Testierfähigkeit einzuholen, wenn ein Testament errichtet wird.
Für die Testamentserrichtung gibt es folgende Möglichkeiten:
- Das eigenhändige Testament ist selbst geschrieben (handschriftlich), mit Ort und Datum versehen und selbst unterschrieben.
- Das fremdhändige Testament ist vorgeschrieben (z.B. am Computer) und bedarf neben der Unterschrift der*des Testator*in auch eines eigenhändig geschriebenen Zusatzes, dass die Urkunde ihren*seinen letzten Willen enthält (neu seit 2017). Die Zeug*innen, deren Identität aus der Urkunde hervorgehen muss, müssen bei ihrer Unterschrift auch handschriftlich festhalten, dass sie „als Testamentszeuge“ unterschreiben.
- Wenn die*der letztwillig Verfügende nicht schreiben kann, muss sie*er statt der Unterschrift und des eigenhändigen Zusatzes ihr*sein Handzeichen in Gegenwart der drei Zeugen eigenhändig setzen und ausdrücklich vor ihnen erklären, dass die Urkunde ihr*sein letzter Wille ist. Die Zeugen bestätigen dies dann mit ihrer Unterschrift.
- Wer nicht lesen kann, muss sich die fremdhändige Verfügung von einer*einem Zeug*in in Gegenwart der beiden anderen Zeug*innen, die den Inhalt eingesehen haben, vorlesen lassen und bekräftigen, dass dieser seinem Willen entspricht.
Ein Testament muss also nicht zwingend vor einem Notar oder Rechtsanwalt errichtet werden. Es empfiehlt sich aber jedenfalls, vor der Errichtung juristischen Rat einzuholen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Wille des Erblassers nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch zur Gänze umgesetzt wird und es im Ablebensfall nicht zu einer Erbfolge kommt, die vom Erblasser nicht gewollt war.
Medizinische Entscheidungen
Wie in allen Angelegenheiten gilt auch für medizinische Entscheidungen: Personen, die hinsichtlich der betroffenen Materie einsichtsfähig sind, können (nur!) selbst entscheiden, ob eine medizinische Behandlung durchgeführt werden soll. Auch Personen mit Erwachsenenvertreter*in können selbst entscheiden. Ob die*der Patient*in entscheidungsfähig ist, beurteilt die*der Ärzt*in im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs.
Ist die*der Patient*in nicht entscheidungsfähig, so soll sie*er durch Angehörige, nahestehende Personen, Vertrauenspersonen oder besonders geübte Fachleute bei der Entscheidungsfindung unterstützt werden. Dies kann die*der Patient*in allerdings auch ablehnen.
Wenn die Person auch mit Unterstützung nicht entscheidungsfähig ist, entscheidet die Vertretungsperson nach dem Willen der*des Patient*in. Voraussetzung dafür ist, dass die Vertretungsperson eine Vertretungsbefugnis für medizinische Behandlungen hat, also beispielsweise eine gewählte Erwachsenenvertreterin für solche Angelegenheiten bestellt wurde.
Auch Menschen, die nicht entscheidungsfähig sind, müssen über die Grundzüge der medizinischen Behandlung informiert werden.
Besteht Uneinigkeit zwischen der nicht entscheidungsfähigen Person und ihrem Vertreter über eine medizinische Behandlung, so ist das zuständige Bezirksgericht zu verständigen, das hier dann eine Entscheidung zu fällen hat. Im Zweifel ist dabei davon auszugehen, dass die vertretene Person eine medizinisch indizierte Behandlung wünscht.
Persönliche Entscheidungen (Eheschließung)
Angelegenheiten, die in der Persönlichkeit oder in familiären Verhältnissen einer Person gründen, dürfen nur von einer*einem Vertreter*in besorgt werden, wenn sie vom Wirkungsbereich des Vertreters umfasst sind, die vertretene Person nicht entscheidungsfähig ist und die Vertretungshandlung zur Wahrung des Wohles der vertretenen Person erforderlich ist. Gibt die vertretene Person zu erkennen, dass sie die geplante Vertretungshandlung ablehnt, so hat diese bei sonstiger Rechts-unwirksamkeit zu unterbleiben.
In manchen persönlichen Angelegenheiten ist eine Vertretung jedoch aus-geschlossen: Das Eingehen einer Heirat ist ein höchstpersönliches Recht, das jeder Mensch nur für sich selbst ausüben kann. Eine Vertretung ist nicht möglich. Grundsätzlich können volljährige und entscheidungsfähige Personen heiraten. Die Entscheidungsfähigkeit gilt als gegeben, wenn eine Person versteht, was eine Ehe ist. Dies beurteilt die*der Standesbeamt*in.
Auch eine Scheidung kann nur die*der Ehegattin persönlich in die Wege leiten. Wenn eine Scheidung jedoch zur Wahrung des Wohls einer geschäftsunfähigen Person vorgenommen werden muss, so ist hinsichtlich der Scheidung eine Vertretung möglich.
Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Personen mit Behinderung so weit wie möglich selbst über ihr Leben entscheiden können und auch können sollen. Wenn Einsichtsfähigkeit gegeben ist, kann die Person eine Entscheidung selbst treffen und somit gültige Rechtshandlungen setzen. Für Bereiche, in denen keine Entscheidungsfähigkeit gegeben ist, kann ein*e gewählte Erwachsenenvertreter*in bestellt werden. Diese*n wählt die betroffene Person selbst aus.
Die rechtlichen und faktischen Möglichkeiten können in einem Erstgespräch mit RA Dr. Susanne Freyer ausführlich besprochen und reflektiert werden.
Termine können telefonisch unter 02242-20300 vereinbart werden.
MMag. Dr. Susanne Freyer
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht