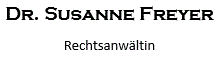Das Testament
Wenn zu Lebzeiten kein Testament errichtet wurde, dann gilt das gesetzliche Erbrecht. Dieses sieht z.B. vor, dass der Ehegatte neben den Kindern ein Drittel erbt, neben den Eltern des Verstorbenen zwei Drittel. Es sieht hingegen grundsätzlich kein Erbrecht für Lebensgefährten vor!
Will man dies abändern, muss ein Testament errichtet werden – die gesetzliche Erbfolge kommt dann nur mehr in Form des !Pflichtteils! zur Anwendung. Dies bedeutet, dass der Ehegatte und die Kinder den Pflichtteil zwingend erhalten müssen, dieser ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
Für die Testamentserrichtung gibt es folgende Möglichkeiten:
- Das eigenhändige Testament ist selbst geschrieben (handschriftlich), mit Ort und Datum versehen und selbst unterschrieben.
- Das fremdhändige Testament ist vorgeschrieben (z.B. am Computer) und bedarf neben der Unterschrift des Testators auch eines eigenhändig geschriebenen Zusatzes, dass die Urkunde seinen letzten Willen enthält (neu seit 2017). Die Zeugen, deren Identität aus der Urkunde hervorgehen muss, müssen bei ihrer Unterschrift auch handschriftlich festhalten, dass sie „als Testamentszeuge“ unterschreiben.
- Wenn der letztwillig Verfügende nicht schreiben kann, muss er statt der Unterschrift und des eigenhändigen Zusatzes sein Handzeichen in Gegenwart der drei Zeugen eigenhändig setzen und ausdrücklich vor ihnen erklären, dass die Urkunde sein letzter Wille ist. Die Zeugen bestätigen dies dann mit ihrer Unterschrift.
Ein Testament muss also nicht zwingend vor einem Notar oder Rechtsanwalt errichtet werden. Es empfiehlt sich aber jedenfalls, vor der Errichtung juristischen Rat einzuholen. So ist etwa das Thema der Pflichtteilsberechtigungen zu besprechen (man kann den Pflichtteil auch auf die Hälfte reduzieren, wenn nahezu kein Kontakt zum Pflichtteilsberechtigten besteht) – es ist auch das Thema von Schenkungen zu berücksichtigen, die bereits zu Lebzeiten gemacht worden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Wille des Erblassers nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch zur Gänze umgesetzt wird und es im Ablebensfall nicht zu einer Erbfolge kommt, die vom Erblasser nicht gewollt war.
Einfache eigenhändige Testamente können im Rahmen einer mündlichen Rechtsberatung besprochen und auch errichtet werden, ebenso ist die Überprüfung eines bereits bestehenden Testamentes in einer mündlichen Rechtsberatung möglich. Bei komplexeren Sachverhalten empfiehlt sich die Errichtung eines anwaltlich errichteten Testaments, wobei die erforderlichen Zeugen von der Kanzlei Dr. Freyer bereitgestellt werden.
Termine können telefonisch unter 02242-20300 vereinbart werden.
MMag. Dr. Susanne Freyer